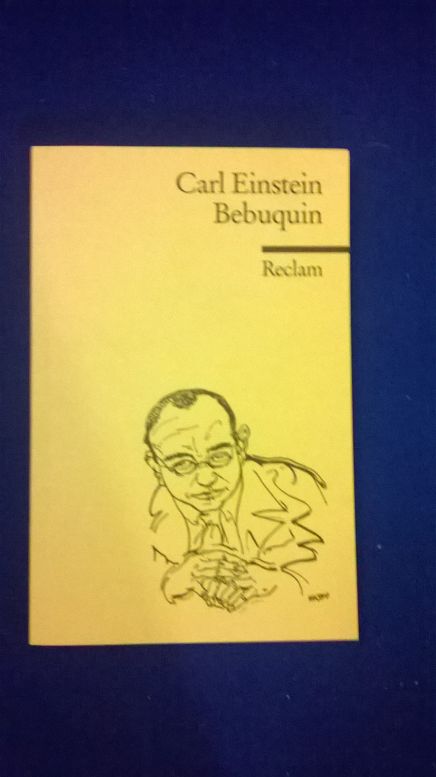
Wie rezensiert man ein Buch, das sich alle Mühe gibt, keins zu sein? Carl Einstein war eigentlich Kunsthistoriker und veröffentliche zum Beginn des 20. Jahrhunderts in expressionistischen Literaturmagazinen. Sein Roman Bebuquin gilt als wegweisender expressionistischer Roman. Schon mehrere Male wurde er in unserem Grundkurs erwähnt. Also dachte ich mir, ich lese ihn mal. Der Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages, der bei uns traditionell sehr ruhig ist, bot sich dafür gut an – und gegen Nachmittag hatte ich meine Verstörtheit nach dem Lesen soweit abgebaut, dass ich feiertagskompatibel war.
Was soll ich zum Inhalt sagen? Es dreht sich irgendwie um den Herrn Bebuquin, der nach dem Wunder, der Vollendung sucht. Aber er ist zum Scheitern verurteilt, weil es ein Wunder, nach dem er sucht, gar nicht gibt. Zusammen mit Nebukadnezar Böhm und Euphemia sucht er dannach, aber keiner von ihnen kann es finden. Wobei die Formulierung „Es dreht sich um“ nicht zutreffend ist, denn keine der Personen trägt irgendeine Handlung. Es gibt keine Handlung im klassischen Sinne, es gibt aber Dialoge, die keine echten Dialoge sind, weil nur nebeneinander her gesprochen wird. Die drei wollen sich selbst finden, Euphemia gebärt ein Kind, dessen Vater sie nicht kennt, der Tod ist allgegenwärtiges Thema. Aber was passiert? Ich kann es euch nach der Lektüre des Buches samt dem Apparat nicht sagen.
Nun, es ist ein expressionistischer Roman. Oder das, was es sein könnte. In der Literatur wird im Kontext des Romans die Monographie „Theorie des Romans“ von George Lukács erwähnt. Die habe ich allerdings (noch) nicht gelesen. Klar ist nur: Das ist kein Roman. Es ist ein Prosatext, aber er hat keine Handlung. Es ist ein sehr eindrucksvoller Text. Man könnte es als ~50 Seiten Lebensgefühl des frühen 20. Jahrhunderts bezeichnen. Es ist gelebte Ruhelosigkeit. Sinnsuche in der Sinnlosigkeit, denn einen Sinn gibt es längst nicht mehr. Eigentlich nur eine Form von Warten auf den Tod, der sich vom Leben aber auch kaum noch unterscheidet. Es ist eine gelebte Ohnmacht, ein Rausch, eine Groteske.
Okay, ich versuche es mal strukturiert vorzugehen. Auf rund 50 Seiten breitet Einstein seine Sicht von der Welt aus. Einstein verneint einen Sinn und verneint Objektivität. Es gibt nur das Subjektive, das selbst erlebte. Es ist eine Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen seiner Zeit und eine Projektion der Verlorenheit des Subjekts. Dabei tauchen die oben genannten Figuren auf und scheinen miteinander zu sprechen. Aber sie tun es nicht.
Sprachlich unterscheidet sich der Bebuquin von allem, was ich bisher gelesen habe. Höchstens Hoffmannsthals „Ein Brief“ kommt annähernd an das heran, was hier präsentiert wird. Der Bebuquin ist sprachlich hoffnungslos überladen, so hoffnungslos, dass es nichts mehr ausdrückt. Die Sprache ist völlig ins Absurde verkehrt und die Sprachkrise ist omnipräsent. Sie kann nichts mehr ausdrücken, jegliche Bedeutung ist ihr fremd.
Was bleibt also? Ein Zeitzeugnis, eine Konfrontation mit dem Fremden. Den Bebuquin zu lesen lässt einen verwirrt zurück? Was habe ich da gerade gelesen? Es ist eine Erinnerung daran, dass uns unsere bekannten Formen so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass uns eine Abweichung aufs Höchste verstört. Der Bebuquin ist kein Roman im klassischen Sinne, sondern etwas völlig anderes. Ein Bruch mit allem, was man sich vorstellt. Ein Bruch mit allem, was vorher war und mit dem, was danach kommen wird.
Nun, ich könnte wahrscheinlich ewig so weitermachen. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und empfehle euch, einfach mal ein paar Zeilen im Gutenberg-Projekt zu lesen. Eine Wertung kann und will ich für diesen Text nicht abgeben.
Pingback: Neuzugänge #15 – November/Dezember 2014 | Romanfresser.de
Pingback: Statistik für Dezember | Romanfresser.de